Die letzte Bundesregierung („Ampel“) hat weder wirksame Mietenregulierungen umgesetzt noch den Bau bezahlbarer Wohnungen ausreichend angekurbelt, aber das Wohngeld erhöht. Ob sich bei der nächsten Bundesregierung, wahrscheinlich unter CDU-Führung, daran etwas ändert, ist zweifelhaft: Auch bei den Unionsparteien ist eher das Wohngeld das Mittel der Wahl. Der Berliner Senat gewährt Mieter:innen in Härtefällen weitere Miethilfen. Diese sogenannten Subjektförderungen haben eines gemeinsam: Mieter:innen müssen für diese Leistungen komplizierte Anträge ausfüllen, über ihre Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse bis ins Detail Auskunft erteilen – und am Ende landet das Geld über die Mietzahlung doch komplett bei den Vermieter:innen.
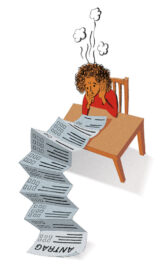
Wie kann Wohnen bezahlbar gehalten werden? Der Staat setzt dafür Fördergelder auf zwei verschiedene Arten ein: mit der Objektförderung und mit der Subjektförderung. Bei der Objektförderung fließt das Geld in die Immobilie: Im Sozialen Wohnungsbau fördert der Staat den Bau von Wohnungen, die für einen bestimmten Zeitraum zu reduzierten Mieten an geringverdienende Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein vergeben werden. Auch die Modernisierungsförderung und der Ankauf von Belegungsbindungen im Wohnungsbestand zählen zur Objektförderung.
Die Subjektförderung richtet sich hingegen direkt an die wohnenden „Subjekte“, also die Mieter:innen. Sie sollen mit Unterstützungszahlungen in die Lage versetzt werden, die unreglementierten Mieten auf dem freien Markt zu bezahlen und sich so mit dem benötigten Wohnraum zu versorgen. Dazu gehören das Wohngeld, die Kosten der Unterkunft im Bürgergeld sowie Zuschüsse und Mietreduzierungen für bestimmte Härtefälle.
Der Bund hat seine Mittel für den Sozialen Wohnungsbau im Jahr 2024 von 2,5 auf 3,15 Milliarden Euro aufgestockt und damit den Bau von rund 30.000 Sozialwohnungen gefördert. Auf der anderen Seite stehen 19,5 Milliarden Euro für Wohngeld und Kosten der Unterkunft. Die Unterstützungszahlungen für Mieter:innen sind also sechsmal so hoch wie die Förderung für den Neubau von Sozialwohnungen.
Wo die Unterstützungsgelder hinfließen
Konservative und wirtschaftsliberale Parteien wie CDU und FDP bevorzugen offensiv die Subjektförderung. Um die Bezahlbarkeit des Wohnens zu sichern, setzen sie vor allem auf das Wohngeld – und nicht auf strengere Mietpreisregulierungen. Man gibt Vermieter:innen einen Freibrief für Mieterhöhungen und zahlt aus dem Staatssäckel Geld an die Mieter:innen, damit diese die Mieten tragen können – und es letztlich zu den Vermietenden weitertragen. Denn die Mittel sind keine Wohltaten für bedürftige Mieter:innen, sondern sollen nur die Miete für den nötigsten Wohnbedarf abdecken. Das Geld fließt letztlich vollständig den Vermietenden zu und befriedigt deren Einnahmeerwartungen. Nicht selten werden die Mieten von ihnen so gestaltet, dass sie den Rahmen der Wohnkostenverordnungen bis zur äußersten Grenze ausreizen.

Illustration: Julia Gandras
Indem der Staat ganz überwiegend auf die Subjektförderung setzt, schiebt er Verantwortung auf die Mieter:innen ab, denn um die Wohnkostenübernahme, das Wohngeld und andere Härtefallzuschüsse müssen sie sich selbst bemühen. Sie müssen dazu ihre Bedürftigkeit nachweisen, gegenüber Behörden und Vermietenden ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen, sich womöglich überhaupt erstmal beim Jobcenter als „Kunde“ registrieren, obwohl sie über einen Arbeitsplatz verfügen, erheblichen Papierkram bewältigen und aufgrund der Überlastung der Ämter oft monatelang auf Bescheide warten.
Erfahrungsgemäß beantragen viele Berechtigte die ihnen zustehenden Leistungen nicht. Die Gründe sind: Unwissen, Überforderung, Scham oder weil man einfach nicht als „Sozialfall“ behandelt werden will.
Transferleistungen mit „eingebautem“ Wohngeld
Das Wohngeld ist kein Almosen, sondern ein staatlicher Mietzuschuss, auf den Geringverdienende, die keine anderen Sozialleistungen bekommen, einen Anspruch haben. Wie viel Wohngeld man erhält, hängt vom Einkommen, von der Zahl der Haushaltsmitglieder und von der Miethöhe ab. Ausgeschlossen sind Haushalte mit einem Vermögen von mehr als 60.000 Euro plus 30.000 Euro für jede weitere im Haushalt lebende Person. Von der Unterstützung mit Wohngeld ausgenommen sind Menschen, die Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe, BAföG oder andere Transferleistungen beziehen, denn in diesen Zahlungen sind die Wohnkosten schon berücksichtigt. Wer aber Bürgergeld bekommen möchte, wird vom Jobcenter häufig aufgefordert, erst einmal einen Wohngeldantrag zu stellen. Wohngeld muss man grundsätzlich selbst beim Wohnungs- beziehungsweise Bürgeramt seines Bezirks beantragen.

Illustration: Julia Gandras
Das Wohngeld wurde 1965 in der Bundesrepublik als Trostpflaster für die Aufhebung der allgemeinen Mietpreisbindung eingeführt und seither mehrfach angepasst. Mit der Wohngeldreform von 2023 wurde das „Wohngeld plus“ durch eine Heizkostenpauschale deutlich erhöht und der Kreis der Berechtigten ausgeweitet. Zudem sollte die Beantragung einfacher werden. Seit zwei Jahren geht das Beantragen in Berlin auch vollständig digital. Mit dem Wohngeldrechner der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung lässt sich online schnell ermitteln, ob man einen Anspruch auf Wohngeld hat und wie viel man bekommen kann.
Der Onlineantrag ist auch für Geübte herausfordernd
Doch offensichtlich erreicht das Wohngeld auch nach der Reform immer noch nicht alle berechtigten Haushalte. Zwar stieg bundesweit die Zahl der Wohngeld empfangenden Haushalte um 80 Prozent auf 1,17 Millionen. Der Bund hatte allerdings sogar eine Verdreifachung erwartet. In Berlin wuchs die Zahl um 85 Prozent auf 51.000 Haushalte – vorausgesagt hatte man „mindestens 75.000“. Die Beihilfe stieg von durchschnittlich 191 Euro im Monat auf 297 Euro. Auch dieser Wert blieb deutlich hinter der Prognose von 370 Euro zurück. Insgesamt hat der Bund im Jahr 2023 über 4,3 Milliarden Euro für das Wohngeld ausgegeben.
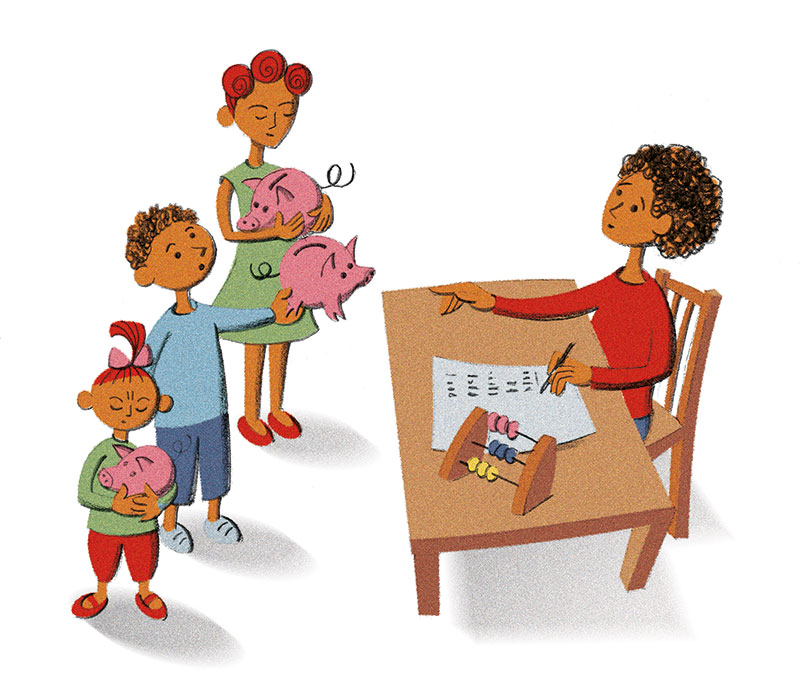
Illustration: Julia Gandras
Trotz der Vereinfachung sind bei einem Wohngeldantrag immer noch elf Seiten auszufüllen und eine Menge an Dokumenten, Nachweisen und Kopien einzureichen: Dazu gehören Ausweiskopien aller Haushaltsmitglieder, Gehaltsbescheinigungen oder Einkommensteuerbescheide, der Mietvertrag, Mieterhöhungsschreiben und Mietzahlungsquittungen oder Kontoauszüge der letzten drei Monate, Nachweise zu Kinderbetreuungskosten, Unterhaltszahlungen, Werbungskosten oder Schwerbehinderungen, zudem gegebenenfalls Bescheide über Transferleistungen, Nachweise über Vermögen oder den Aufenthaltstitel. Richtig kompliziert wird es, wenn noch ein Zimmer untervermietet ist, wenn eine Wohngemeinschaft besteht oder wenn etwa ein Kind BAföG bezieht. Das kann schon entmutigen.
Die Möglichkeit der Online-Antragstellung ist für viele Wohngeldberechtigte – etwa zwei Drittel von ihnen sind im Rentenalter – nicht unbedingt eine Erleichterung. Dokumente abzufotografieren oder einzuscannen, in die geforderten Dateiformate PDF oder JPG zu bringen und diese gebündelt in einer Dateigröße von höchstens 30 MB hochzuladen, geht selbst vielen Jüngeren nicht so leicht von der Hand.
Bewilligt wird das Wohngeld in der Regel für ein Jahr, ausnahmsweise auch für zwei Jahre – aber immer erst ab dem Monat, in dem der Antrag eingereicht wurde. Man sollte also keine Zeit vergeuden.
In Berlin gilt für die 360.000 Mietparteien der landeseigenen Wohnungsunternehmen das „Leistbarkeitsversprechen“. Es ist in der Kooperationsvereinbarung der sechs Wohnungsbaugesellschaften mit dem Senat festgeschrieben: Wenn die Nettokaltmiete mehr als 27 Prozent des Einkommens ausmacht, können Mieter:innen bei ihrer Wohnungsbaugesellschaft eine Mietabsenkung beziehungsweise die Kappung einer Mieterhöhung beantragen.
Kein Miethilfe-Antrag, also Miete bezahlbar?
Das tun aber nur sehr wenige. Im Jahr 2023 – damals war die Mietbelastungsgrenze noch bei 30 Prozent festgelegt – haben nur 65 Haushalte diese Entlastung beantragt. Bewilligt wurde sie in lediglich 37 Fällen, also bei 0,01 Prozent aller potenziell berechtigten Haushalte. Diese verschwindend geringe Zahl nimmt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung als Beleg, „dass die Bestandsmieten für die Mieterinnen und Mieter leistbar sind“, wie es in einem jüngst veröffentlichten Bericht heißt. Dabei liegt der Gedanke nicht allzu fern, dass viele Menschen die aufwendige Beantragung scheuen, zumal die Erfolgsaussichten auch ziemlich ungewiss sind. Im Jahr 2023 wurden 43 Prozent der Anträge abgelehnt, im Jahr zuvor sogar 62 Prozent. Viele Anträge scheitern, weil die Mieter:innen nicht vorher geprüft haben, ob sie einen Wohngeldanspruch haben. Dass dies eine Voraussetzung ist, geht aus den Veröffentlichungen der Wohnungsbaugesellschaften zum Leistbarkeitsversprechen nicht deutlich hervor.
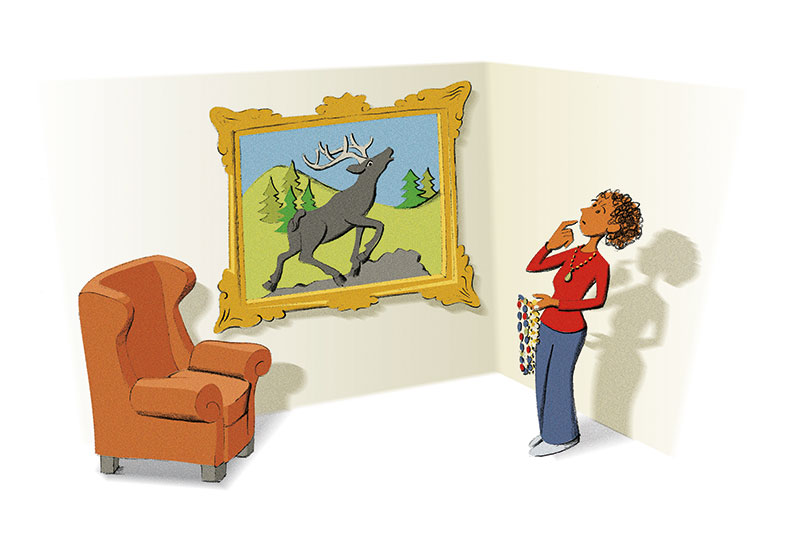
Illustration: Julia Gandras
Für Mieterhaushalte in Sozialwohnungen, die mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Bruttowarmmiete ausgeben, gibt es in Berlin einen Mietzuschuss. Das bezieht sich allerdings nur auf solche Sozialwohnungen, die bis 2002 im „ersten Förderweg“ errichtet wurden. Aktuell sind das rund 85.000 Wohnungen. Durch das Auslaufen der Bindungen reduziert sich diese Zahl nach und nach.
Kleineres Formular – größerer Aufwand
Der Mietzuschuss wurde 2016 als Reaktion auf das erfolgreiche Mietenvolksbegehren eingeführt. Damit wollte man der Absurdität entgegenwirken, dass Sozialwohnungen teurer sind als Wohnungen auf dem freien Markt. Den Mietzuschuss muss man bei der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragen. Auch wenn das Jobcenter oder das Sozialamt nach einem Kostensenkungsverfahren nicht mehr die volle Miete übernimmt, kann man diesen Mietzuschuss erhalten. Ähnlich wie beim Bezug eines Wohnberechtigungsscheins gelten Einkommensgrenzen, und es werden je nach Personenzahl nur bestimmte Wohnungsgrößen angerechnet – bei einem Zweipersonenhaushalt beispielsweise die Kosten für höchstens 65 Quadratmeter. Der Zuschuss wird maximal für zwei Jahre bewilligt, Folgeanträge sind möglich.
Auch wenn das Antragsformular mit fünf Seiten deutlich kürzer als der Wohngeldantrag ist, muss man viel mehr Aufwand betreiben, um den Mietzuschuss zu bekommen. Es ist neben der Einkommensbescheinigung vom Arbeitgeber auch noch eine Einkommenserklärung auszufüllen, die es in sich hat. Man muss dort neben regelmäßigem Einkommen auch einmalige Einnahmen angeben und alle Vermögenswerte auflisten. Dazu gehören Immobilien und Grundbesitz – die wohl kaum ein Sozialmieter hat – sowie Geldvermögen und Sachwerte, die genau beziffert werden müssen. Die Erläuterungen zum Antrag zählen auf, was darunter zu verstehen ist: „Schmuck, Möbel und Haushalts-/Einrichtungsgegenstände, Kunstgegenstände (wie zum Beispiel Malereien, Grafiken, Zeichnungen, Plastiken und so weiter), Sammlungen (wie zum Beispiel Bücher, Münzen, Briefmarken, Puppen, Mineralien und so weiter), Musikinstrumente, Sonstiges“. Damit wird den Antragstellenden signalisiert, dass hier jeder Stein umgedreht wird. Verlangt werden auch Angaben zu Kinderbetreuungskosten und Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehegatten oder andere Familienmitglieder sowie alle erdenklichen Nachweise und Belege: Heiratsurkunde, Geburtsurkunde der Kinder, Scheidungsurteil, Sorgerechtserklärung, Unterhaltsurteil, Erklärung über den Kindesaufenthalt und bei Schwangerschaft auch der Mutterpass und eine Vaterschaftsanerkenntnis – die staatliche Wissbegier greift tief in die Privatsphäre ein. Eine solche Einkommenserklärung ist noch dazu für jedes einzelne Haushaltsmitglied abzugeben, sogar für Kinder.
Tiefer Griff in die Privatsphäre
Die Zahl der Anträge blieb bisher weit unter den Erwartungen. Anfangs rechnete der Senat damit, dass von den damals 116.000 Sozialmiethaushalten 22.600 zuschussberechtigt wären. In den ersten vier Monaten wurden aber nur 600 Anträge gestellt. Im Jahr 2023 wurden 1945 von 2331 gestellten Anträgen bewilligt. Im Schnitt bekamen die Haushalte 263 Euro im Monat.
Solche Hilfen sind für die betroffenen Mieter:innen zweifellos wichtig, um überhaupt eine angemessene Wohnung bezahlen zu können. Für Stadt und Gesellschaft wäre es allerdings günstiger, in den Bau von dauerhaft bezahlbarem Wohnraum zu investieren und den nahezu ungebremsten Anstieg der Mieten zu stoppen. Ein wirksamer Mietendeckel, der die Abzocke auf dem Mietmarkt beendet, würde nichts kosten, aber viele Zahlungen von
Wohngeld & Co. überflüssig machen.
Jens Sethmann
„… eine würdelose Zumutung“
MieterMagazin: Subjektförderungen wie das Wohngeld sind für viele Mieter:innen notwendig, die Leistungen landen aber letztlich in den Taschen der Vermieter:innen. Wie steht der Berliner Mieterverein dazu?
Hamann-Onnertz: Subjektförderungen machen Mieter:innen de facto zu Bittstellenden, denn sie müssen ihre gesamten Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen, wenn sie einen Antrag auf Wohngeld, Mietzuschuss oder Härtefall stellen. Sie tun dies nur, damit sie an die Eigentümer:innen die Miete bezahlen können. Vielen ist eine solche Offenlegung ihrer Verhältnisse sehr unangenehm, auch wenn sie gesetzlich ein Anrecht auf diese Leistungen des Staates oder Landes haben. Stellen wir uns mal den Fall umgekehrt vor und drehen die Nachweispflicht um: Wenn die Vermietenden nachweisen müssten, warum die Mieten so hoch sein müssen, dann könnten wir die Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt sicherlich gerechter ordnen.

Foto: BMV
MieterMagazin: Ist die Beantragung der Leistungen zu kompliziert?
Hamann-Onnertz: Uns erreichen oft Beschwerden von Mieter:innen, dass sie die Menge der Nachweise für die Zuschüsse zur Miete extrem umfangreich und kompliziert finden. Es müssen ja immer alle Einkommensquellen nachgewiesen werden. Stellen wir uns das einmal vor für eine typische Haushaltssituation: Zwei Eheleute – eine Person ist bereits in Rente und erhält die Mindestrente und ein wenig aus einer privaten Altersvorsorge. Die andere Person arbeitet noch auf Minijob-Basis und erhält eine kleine Rente. Zusätzlich haben beide einen Sparbrief bei der Bank, der ein wenig Zinsen abwirft. Sie zahlen Steuern und Kranken- und Pflegeversicherung. Außerdem zahlen sie noch für ein studierendes Kind einen kleinen Zuschuss. Da bleibt bei allem nicht genug für die steigenden Mietkosten. Aber: Sie müssen alle diese Einkünfte und Ausgaben belegen und dem Wohnungsunternehmen beziehungsweise dem Wohnungsamt offenlegen. Das ist eine würdelose Zumutung!
MieterMagazin: Man könnte vermuten, dass es den Bewilligungsstellen vielleicht ganz recht ist, dass längst nicht alle Berechtigten die Leistungen beantragen.
Hamann-Onnertz: Wir wollen nicht darüber spekulieren, ob damit kalkuliert wird und wer davon profitiert, dass eben nicht alle den Antrag stellen. Fakt ist jedoch, dass die Aussage der landeseigenen Wohnungsunternehmen nicht zu halten ist, wenn sie sagen, dass ihre Mieterhöhungen nicht zu hoch sind, weil es ja nicht viele Anträge nach dem Leistbarkeitsversprechen gäbe. Denn das Problem ist doch, dass jeder Haushalt, der Anspruch auf das Leistbarkeitsversprechen erheben möchte, erst alle anderen Anträge gestellt haben muss, also Wohngeld, Mietzuschuss, gegebenenfalls Transferleistungen.
MieterMagazin: Was wäre die Alternative? Sollte man das Geld lieber in die Objektförderung stecken, um die Mieten allgemein niedrig zu halten?
Hamann-Onnertz: Grundsätzlich gilt: Der Wohnungsmarkt ist völlig aus den Fugen geraten und braucht einen Mietendeckel viel mehr als noch weitere staatliche Gelder in der Subjektförderung, die dann über den Umweg der Mietenden den Wohnungsunternehmen und Vermietenden zugute kommen. So wie es jetzt läuft, fördert der Staat über Umwege die Wohnungswirtschaft und die Eigentümer:innen, und nicht die Menschen, deren Einkommen nicht mit dem Markt mithalten. Die Gelder, die durch eine kluge Regulierung des Wohnungsmarktes gespart würden, könnten dann in die Objektförderung gesteckt werden, also in die Förderung von Neubau im gemeinwohlorientierten Sektor.
Interview: js
Wohngeld
Informationen über Leistungen und Anträge sowie den Wohngeldrechner der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen finden Sie unter:
www.berlin.de/sen/wohnen/service/wohngeldrechner
Leistbarkeitsversprechen der landeseigenen Wohnungsunternehmen:
inberlinwohnen.de/das-leistbarkeitsversprechen-der-landeseigenen
Mietzuschuss in Sozialwohnungen
Informationen und Antrag bei der IBB:
www.ibb.de/de/foerderprogramme/mietzuschuss-in-sozialwohnungen.html
BMV-Infoblätter
Info 60 zum Wohngeld, Info 43 zum Leistbarkeitsversprechen, Info 53 zum Mietzuschuss in Sozialwohnungen unter:
www.berliner-mieterverein.de/mietrecht/infoblaetter.htm
26.03.2025




