Bürger fordern Verkehrsberuhigung, besetzen Brachen und Freiflächen, wollen sich ihre Parkplätze nicht wegnehmen lassen, ziehen gegen Straßen- und Fassadengestaltungen zu Felde. Behörden und Institutionen fürchten unbequeme Argumente und Zeitverzögerungen, sie wiegeln ab, weichen aus, schaffen vollendete Tatsachen. Argwöhnisch, aber auch kenntnisreich schauen ihnen die Bürger über die Schulter. Sie verlangen immer energischer ein Mitspracherecht.

Foto: Sabine Mittermeier
„Hat er nicht immer noch etwas Pariserisches?“ Beate Jensen schaut mit wehmütigem Stolz aus dem Café hinüber auf den Charlottenburger Meyerinckplatz. Das kleine platanenumstandene Oval verschwindet allerdings hinter fließendem Verkehr und parkenden Autos, die hier Stoßstange an Stoßstange stehen. Die Schauspielerin, die seit Jahren hier wohnt, ist die Organisatorin der Initiative „Bürger für das Quartier Meyerinckplatz“. Sie schlägt eine Mappe auf: Ein Verkehrsgutachten und zwei Verkehrsbeobachtungen in den vergangenen vier Jahren. An einem Wochentag im Juni 2012 wurden von 7.30 bis 14.00 Uhr mehr als 1000 Pkw und 150 größere Fahrzeuge registriert: Lieferwagen, Entsorgungsdienstleister, Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht. Die Radfahrer – 331 waren es an dem Vormittag – dürften einige Mühe gehabt haben, durchzukommen, zumal sich immer wieder Staus bildeten, weil Fahrzeuge in der zweiten Reihe parkten. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Die schmale Giesebrechtstraße, die nur in eine Richtung befahrbar ist, wird als Abkürzung missbraucht, wenn es auf dem Kurfürstendamm Stau gibt. Die Parkplätze rundum sind zu 100 Prozent ausgelastet. Sowohl Zählung als auch Gutachten sind von der Bürgerinitiative in Auftrag gegeben worden. Beate Jensen: „Wir wollen eine Verkehrsberuhigung erreichen.“ Über ihr Anliegen verhandeln sie seit Jahren mit dem Bezirksamt Charlottenburg. Denn das ist für dieses Problem zuständig.

Foto: Sabine Mittermeier
„Öffentlicher Raum“, erklärt die Architektin Barbara Hoidn, „umfasst Parks und Anlagen, Straßen und Plätze, Unterführungen und Durchgänge, aber auch Verkehrsmittel und Verkehrswege – eben alles das, was von der öffentlichen Hand unterhalten wird.“ Vor allem für dicht besiedelte Metropolen sind öffentliche Räume lebenswichtig: Sie bieten Flächen für gemeinsames Erleben und Kommunikation, versprechen aber auch Privatheit und Anonymität. Sie sind große Bühne für Kunst und politische Bekundungen. Öffentliche Räume bieten Platz zum Spielen, Träumen, Ausruhen. Sie dienen der Mobilität und der Bewegung. Öffentliche Räume seien das „Betriebssystem“ unseres Lebens im 21. Jahrhundert. So heißt es im Katalog zur Ausstellung „Demopolis – Das Recht auf öffentlichen Raum“, die von den Architekten Barbara Hoidn und Wilfried Wang in diesem Jahr in der Akademie der Künste organisiert und kuratiert wurde. Am Meyerinckplatz ist dieses Betriebssystem klar überlastet.
Veränderungen um den Platz mit den schönen Gründerzeitbauten vollziehen sich seit Jahrzehnten: Der Brunnen, der den Krieg überdauert hatte, verschwand in den 1950er Jahren. Die Ruhe und Einfachheit mit kleinem Gemüse- und dem Zeitungsladen wich nach und nach mondäneren Geschäften, einem Café und Restaurant, einer Boutique und Galerien. Der Fall der Mauer ließ den Verkehrsstrom deutlich anschwellen, er überrollte den kleinen Platz förmlich. Als aber das Kino „Die Kurbel“ – ältestes Tonfilmkino in Berlin und markantestes Wahrzeichen des Meyerinckplatzes – einem Bio-Supermarkt weichen sollte, war das Maß voll. 12.000 Menschen protestierten gegen dessen Schließung und konnten sie doch nicht verhindern. In dieser Zeit schlossen sich die Anwohner zusammen und forderten Mitsprache ein. „Die Frage ist doch“, so Barbara Hoidn, „wieviel Einfluss haben Bürger auf den Ort, an dem sie leben?“

Foto: Sabine Mittermeier
Kampfzone für Interessen und Anforderungen
Der öffentliche Raum ist zu einer umstrittenen Zone geworden, in der verschiedene Interessen und Anforderungen miteinander ringen. Der immer entschiedener und – wie es scheint – auch kompromissloser geführte Kampf um Beteiligung an seiner Planung und Ausgestaltung zeugt von zunehmendem bürgerschaftlichen Selbstbewusstsein, aber auch von stetig wachsendem Interesse am Leben in der Stadt. Nach vielen Jahren des Rückzugs ins Private, in die eigenen vier Wände und an den grünen Rand der Städte, entdeckten die Bürger zu Beginn der 1990er Jahre die Zentren neu. Es belebten sich die Plätze und Straßen wieder, auf Grünflächen und Brücken wird gelagert und gefeiert, Scharen von Touristen, aber auch Einheimische ziehen durch Boulevards und Passagen. Bewohner besetzen die Nischen und Brachen, gestalten Ödnis, gärtnern und genießen dort ihre Freizeit. „Das ist nicht etwa nur in Berlin so“, sagt Wolfgang Kaschuba, Leiter des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. „Fast überall in Mittel- und Nordeuropa verzeichnen wir diesen Trend zur Neuentdeckung des öffentlichen Raums – und damit eine Renaissance der Stadt.“

Foto: Sabine Mittermeier
Die wurde schon in den 1970er und 1980er Jahren vorbereitet. Mit Aktionen wie „Rettet unsere Städte jetzt“ schufen Kommunen mehr und mehr Angebote. Kaschuba: „In der Zeit sind beispielsweise zwei- bis dreitausend Museen in Deutschland gebaut worden, es gab Events, Festivals, die ersten italienischen Eiscafés öffneten – auch wenn man erst mal nur drinnen sitzen konnte.“ Bald war auch „draußen“ angesagt, selbst wenn es noch so kalt war. Heute steht der Caféhaus-Tisch auf dem Gehweg der Straße, gegessen wird direkt neben parkenden Autos, und auch Passanten scheinen niemanden mit ihrem Blick auf den Teller beim Essen zu stören.
Die Frage „Bleiben wir in der Stadt, oder ziehen wir raus in die Natur?“ wird von immer weniger Familien gestellt. Die Natur in der Stadt ist gefragt. „Und kaum eine andere Stadt hat so viel Grün wie Berlin“, erklärt Wolfgang Kaschuba. Über 2500 Parks und öffentliche Gärten sind für alle Bürger und ihre Besucher geöffnet. Darüber hinaus wird begrünt, werden Baumscheiben gepflegt, Baulücken temporär in Kleinanbauflächen verwandelt.
Als der Flughafen Tempelhof 2008 seinen Betrieb einstellte, lag da eine 380 Hektar große Brachfläche, für die es vorerst keine Nachnutzung gab. So wurde das gewaltige Areal inmitten der Stadt – mit minimalen Einschränkungen – erst einmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die nahm das traditionsreiche Gelände sofort begeistert in Besitz. Was nur als Zwischennutzung gedacht war, erwies sich aber als „Landnahme“ im großen Stil. Die hauptstädtische Planung einer Randbebauung mit Wohnen und Gewerbe, mit angelegten Sport- und Freizeitanlagen, einer Zentral- und Landesbibliothek wurde per Volksentscheid gestoppt. 64 Prozent der abgegebenen Stimmen votierten im Mai 2014 klar gegen die Berliner Landesregierung.

Foto: Sabine Mittermeier
Die Gründe der Aktivisten des Volksentscheides: Skepsis gegenüber den amtlichen Versprechen, bezahlbare Wohnungen zu bauen. Bedenken, dass mit der Umgestaltung das lokale Ökosystem vernichtet würde. Und schließlich auch die Sorge um den historischen Charakter des Ortes. Mit intelligenten, unkonventionellen Mitteln und mit einem gewaltigen Engagement gelang es ihnen, die große Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen.

Foto: Sabine Mittermeier
„Es ist doch auch so, dass formalisierte Einwände und Einspruchsmöglichkeiten der Öffentlichkeit, wie sie die Planungsverfahren vorsehen, ein mühsamer und meistens nutzloser Weg sind“, erklärt Michael Efler, Bundesvorstandssprecher des „Mehr Demokratie e.V.“: „Die Diskussion setzt da ein, wo eigentlich schon alles gelaufen ist, und ich habe noch nie gehört, dass es so gelungen wäre, ein Projekt zu verhindern.“

Foto: Sabine Mittermeier
Die Organisation begleitet, berät und beobachtet direktdemokratische Verfahren deutschlandweit. Ihre Forderung: Zu allem, was auf Landesebene geregelt wird, sollten Volksentscheide möglich sein. Das sei eine Frage der Bürger-Souveränität, findet Efler. Die Leute würden viel zu oft vor vollendete Tatsachen gestellt, sowohl bei den großen Planungen und Veränderungen, und nahezu immer bei den vielen kleinen Entscheidungen, die das unmittelbare Wohnumfeld betreffen. „Vor meinem Haus fährt die Straßenbahn auf einem Mittelstreifen, der immer mit hohen Bäumen bestanden war“, erzählt Efler. Die seien eines Tages einfach gefällt worden, ohne die Anwohner auch nur zu informieren. „Vielleicht gab es ja einen Grund, vielleicht mussten sie weg, weil sie krank waren und beim nächsten schweren Sturm umgestürzt wären. Das würde ich verstehen – aber wissen möchte ich es schon.“

Foto: Sabine Mittermeier
Mehr Transparenz gefordert
Der Bürgervertreter fordert Transparenz im öffentlichen Raum und mehr Bürgerbeteiligung. Wie schwierig eine wirkliche Partizipation umzusetzen ist und was dabei schief gehen kann, dafür ist die Schöneberger Maaßenstraße ein gutes Beispiel. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Zone zwischen dem U-Bahnhof Nollendorfplatz und Winterfeldtplatz zur ersten „Begegnungszone“ in Berlin umgebaut. Diese Idee zur Verkehrsberuhigung stammt aus der Schweiz und ist eine Möglichkeit, das Konfliktpotenzial bei den Nutzern gerade in hochfrequentierten Straßen und Passagen zu minimieren.
„Wir wurden von den Bewohnern immer wieder angesprochen“, erinnert sich Daniel Krüger (CDU), Baustadtrat im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. „Die Autos würden da viel zu schnell fahren, es gab Beschwerden der Anwohner über Verkehrslärm und Gaststätten, und die Wirte wollten gleichzeitig die Sitzplätzen draußen und ihre Flächen erweitern.“ Und schließlich waren da noch die Radfahrer, die sowieso allen in die Quere kamen. Daraufhin wurde die Maaßenstraße umgebaut. Es gibt einen Mittelstreifen mit Bänken, der durch bunte Betonwürfel gegen die jetzt viel schmalere Straße abgegrenzt ist. Aber: Zufrieden ist damit keiner so richtig. Viele fordern den Rückbau der Maßnahmen.
„Die Straße bleibt ja Straße“
„Die Planung für das Projekt lag bei der Senatsverwaltung“, erläutert Stadtrat Krüger. „Und dort wurde auch eine Bürgerbeteiligung organisiert.“ Schließlich sei ein bunter Strauß von unterschiedlichen Wünschen auf seinem Tisch gelandet, denn der Bezirk ist für die Realisierung der Planungsideen letztlich zuständig. „Da waren Wünsche dabei, die wir gar nicht umsetzen konnten“, so der Baustadtrat. Wie die nach mehr Flächen für die Bewirtung von Gästen oder nach Spielgeräten zwischen den Betonpollern. Krüger: „Trotz Mittelstreifen bleibt die Straße ja eine Straße.“ Da müssten auch gesetzliche Auflagen erfüllt werden, und die Sicherheit muss gewährleistet sein: Freie Zufahrt und Flächen für Feuerwehr, Notarzt und Polizei; Markierungen für Blinde; Poller für die Autos; ausreichend Fahrradständer – all dies schränkt jedoch die Möglichkeiten für Anwohner und Gewerbetreibende ein.

Foto: Sabine Mittermeier
Bei einer Beteiligung an stadtplanerischen Projekten stehen sich die Interessen der Bürger und die Zwänge der Bürokratie nicht selten im Wege. Die Fixierung auf eigene Interessen und unflexibles Denken, aber auch Engagement und Wille zum Miteinander gibt es gleichwohl auf beiden Seiten. Da sind Hausbesitzer, denen es in erster Linie um die Wertsteigerung ihrer Grundstücke geht oder auch Anwohner, denen ihr Autoparkplatz wichtiger ist als jede Wohnumfeldverbesserung. Auf der anderen Seite autoritäres Verwaltungsdenken und die Angst vor Auseinandersetzung. Es gibt die Besserwisser-Bürger, die ihre Proteste mit immer neuen Aktionen befeuern, und die Beteiligungsskeptiker in den Behörden, die auf Bestimmungen und Zwängen beharren. Aber es gibt eben auch Bürger, die ihrer Kommune die Hand reichen und engagierte Bürgermeister, Baustadträte und Verwaltungsmitarbeiter, die sich auf Augenhöhe mit ihnen auseinandersetzen. Das Verhältnis von staatlicher Planung und bürgerschaftlicher Mitbestimmung wird neu ausbalanciert, der Vertrag über den öffentlichen Raum gerade neu verhandelt.

Foto: Sabine Mittermeier
Neue Wege der Protest-Mobilisierung
Eine Rolle spielen dabei zunehmend die digitalen Medien, die eine Kommunikation und damit auch eine Mobilisierung für oder gegen etwas deutlich erleichtert haben. In Tegel Süd wird mit ihrer Hilfe das Unverständnis und der Ärger von Anwohnern gebündelt und der Diskussion eine Plattform eröffnet. Das kommunale Wohnungsunternehmen Gewobag hatte im Rahmen eines Street Art Programms über das Künstlernetzwerk „Urban Nation“ sieben große Wandbilder in Auftrag gegeben. Dabei waren den Künstlern keine Vorgaben gemacht worden – die Vermieterin wollte sich und damit auch die Anwohner von den Motiven überraschen lassen. „Mit den ersten fünf Bildern hatten die Leute keine Probleme“, berichtet Felix Schönebeck. Der Jurastudent ist einer der Mitbegründer der Initiative „I love Tegel“, einer Kiez-Initiative, die im Internet mit vielen Fotos und aktuellen Texten für den Bezirk wirbt.
Als das sechste Wandbild in der Neheimer Straße in Tegel Süd enthüllt wurde, brach ein Sturm der Entrüstung los. Das 42 Meter hohe Bild des spanischen Künstlers Borondo zeigt ein Mädchen, das in einer Blutlache steht. Es schaut durch einen Spalt auf die andere Seite. Da blickt es in einen Wald, und an einem der Bäume ist ein fast nackter, von Pfeilen durchbohrter Mann gebunden. Deprimierend sei das Wandbild, so die Kommentare von Mietern und Bewohnern der umliegenden Häuser. Doch die Auftraggeberin für das Kunstwerk reagierte darauf nicht. Felix Schönebeck wandte sich an die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag. Fehlanzeige. „Weil ich kein Mieter des Unternehmens bin, wollte die Gewobag nicht mit mir reden.“ So setzte er das Problem auf seine Internetseite und aktivierte seine Pressekontakte. Nun wurde das Wandbild quasi über Nacht bekannt und rückte die Kunst, die da an der Peripherie entstanden war, ins Zentrum medialer Aufmerksamkeit.

Foto: Sabine Mittermeier
Auf der Internetplattform „I love Tegel“ meldeten sich innerhalb kürzester Zeit viele Anwohner zu Wort. Schönebeck: „Da gibt es durchaus welche, die die Freiheit der Kunst verteidigen. Aber die meisten lehnen das Wandbild an dieser Stelle ab.“ Ein kritischer Zwischenruf kommt von Migrationsforscher Kaschuba: Kunst im öffentlichen Raum dürfe nicht einfach nur gefällig sein. Sie solle Wirklichkeit abbilden. Und da müsse man eben auch Konflikte aushalten. Das Gegenargument der Wandbildkritiker: Das schließt den Dialog nicht aus. Im Gegenteil: Bürger, die sich nicht übergangen und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt fühlen, sind wesentlich eher bereit zum Nachdenken über ein Projekt.
Rosemarie Mieder
Bürgerbeteiligung: So ist der Ablauf geregelt
Im Paragrafen 3 des Baugesetzbuchs ist die Beteiligung der Öffentlichkeit an Planungsverfahren geregelt. Dazu gehört zunächst die Information der Bürger, beispielsweise durch öffentliche Veranstaltungen, Planaushänge an öffentlichen Orten (Rathaus, Verwaltungsgebäuden, Sparkasse), zunehmend aber auch per Internet („e-Partizipation“).
Die zweite Phase ist eine öffentliche Auslegung. Dabei können Entwürfe der Bauleitpläne sowie Begründungen und umweltbezogene Stellungnahmen für die Dauer von einem Monat öffentlich eingesehen werden.
Besonders diese enge Frist steht in der Kritik. Stellungnahmen zur Planung können nämlich lediglich in der Auslegungsfrist abgegeben werden, nicht fristgerechte Stellungnahmen bleiben bei der Beschlussfassung unberücksichtigt. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung verlangen nahezu zwei Drittel der Bürger von den Behörden eine bessere Informationspolitik über ihre Bau- und Planungsvorhaben. Jeder zweite Befragte möchte die Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung nutzen und sich aktiv in die Prozesse einbringen.
rm
„Fragen stellen statt fertige Pläne vorsetzen“
MieterMagazin: Was bedeutet Bürgerbeteiligung aus Sicht der Planer? Ist das ein notwendiges Übel oder Quelle hilfreicher Anregungen?
Selle: Wer als Planer mit einem fertigen Plan an die Öffentlichkeit geht, wird Bürgerbeteiligung tatsächlich als notwendiges Übel empfinden, weil man dann vor allem Gegenwind zu spüren bekommt. Wer hingegen mit Fragen an die Öffentlichkeit geht, wird eher herausfinden, was Bürger wollen. Das ist dann auch hilfreich.
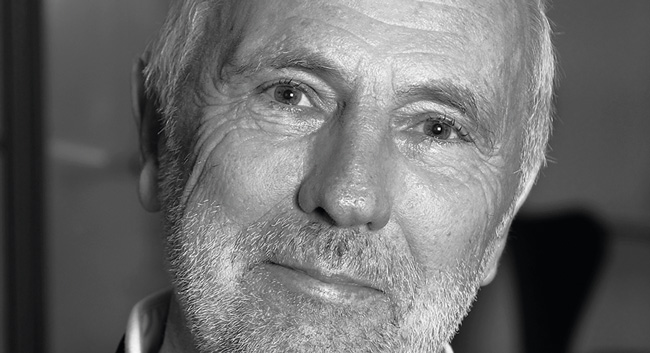
Foto: RWTH Aachen
MieterMagazin: Wie lässt sich das Konfliktpotenzial minimieren? Wie geht man mit egoistischen Forderungen um?
Selle: Den Begriff „egoistische Forderungen“ würde ich streichen. Es gibt Interessen unterschiedlichster Art. Ein Radfahrer will irgendwo schnell durchkommen. Ein Gastronom will Platz, um Tische rauszustellen. Jeder öffentliche Raum ist von vielen Interessen überlagert. Die Aufgabe von Planern ist es, Lösungen zu finden, die möglichst vielen Interessen gerecht werden. Da ist es besser, erstmal Gesichtspunkte zu sammeln als Standpunkte zu vertreten.
MieterMagazin: Wie sollten Kommunen mit den wachsenden Forderungen nach Partizipation umgehen?
Selle: Es beteiligen sich ja überwiegend die Gebildeten aus der Mittelschicht, die sich gut artikulieren können. Es gibt aber Gruppen, die sich fast nie äußern. Kinder und Jugendliche tauchen zum Beispiel selten bei Bürgerversammlungen auf. Auch das migrantische Milieu nimmt wenig teil. Man muss auf diese Gruppen gezielt zugehen, damit deren Interessen nicht untergehen.
MieterMagazin: Werden die gesetzlichen Beteiligungsverfahren, etwa bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, den Anforderungen gerecht?
Selle: Das sind Minimalanforderungen. Es ist gut, dass es sie im Gesetz gibt. Entscheidend ist aber, mit welcher Beteiligungskultur man das Verfahren ausführt. Viele Gemeinden haben Leitlinien zur Bürgerbeteiligung aufgestellt, die weit darüber hinausgehen. Das ist ganz gut, aber auch noch keine Gewähr für eine erfolgreiche Partizipation. Diese kommt durch die Entscheider zustande. Das gilt nicht nur für die öffentliche Verwaltung: Das Beispiel mit dem umstrittenen Wandbild in Berlin, das eine Wohnungsbaugesellschaft hat anbringen lassen, zeigt, dass für bestimmte Player im öffentlichen Raum eine frühzeitige Information der Bürger auch im eigenen Interesse ist.
Interview: Jens Sethmann
18.12.2016




